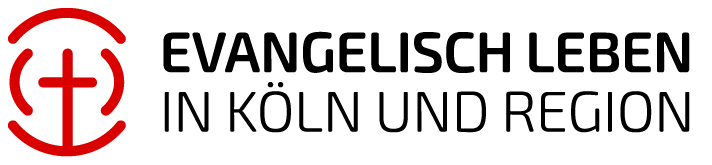Was haben ein Händel-Oratorium, der Roman eines türkischen Schriftstellers und die Komposition eines jungen Musikers aus dem Libanon miteinander zu tun? In einer Veranstaltung in der evangelischen Trinitatiskirche Köln erhielten Besucherinnen und Besucher einen kleinen Vorgeschmack auf die Aufführung des Oratoriums „Israel in Egypt“ von Georg Friedrich Händel, gesungen vom Chor des Bach-Vereins und dem Jugendchor der Evangelischen Lukaskirche Bonn. Auch eine Passage aus der Kantate des 1982 im Libanon geborenen Rabih Lahoud, das „Joseph-Lamento“, kam zum Vortrag. Beides sind Bestandteile eines Philharmonie-Konzerts am 27. März. Und es ist ein bewährtes Format der mitveranstaltenden Melanchthon-Akademie, auf diese Weise „Einblicke“ in Kölner Aufführungen von Theater über Konzert bis zur Oper zu gewähren. Immer mit dabei: Ein Fachmann oder eine Fachfrau, die den Gästen solcher „Schnupperaufführungen“ Einblicke gibt, inhaltliche Linien zu verwandten Wissensbereichen aufzeigt, oder den Kontext des jeweiligen Werks beleuchtet. In diesem Fall waren das Thomas Neuhoff, der künstlerische Leiter des Bach-Vereins und Pfarrer im Ruhestand Dr. Rainer Stuhlmann. Um Musik geht es zwar nur vordergründig in „Fasil“, dem neuen Roman des türkisch-deutschen Autors Dogan Akhanli, aus dem erste Passagen auf Deutsch gelesen wurden. Und doch ergänzte dieser Text die Fragen rund um die Zusammenhänge von Musik und Freiheit. Diese spannende Begegnung verschiedener Kulturen und Kunstrichtungen war eine Veranstaltung, die der Bach-Verein gemeinsam mit der Karl-Rahner- und der Melanchthon-Akademie anbot. Für die letztgenannte ist Akhanli schon seit längerer Zeit als Referent tätig, weshalb sie sich im Namen des Gesamtverbands Ende letzten Jahres auch nachhaltig für die Freilassung des damals zu Unrecht in der Türkei inhaftierten Autors einsetzte. Kurze Zeit später kam der in Köln lebende Türke mit deutscher Staatsbürgerschaft nach vier Monaten Untersuchungshaft wieder frei.
Die Sehnsucht nach Freiheit verbindet
Händels 1739 uraufgeführtes Oratorium „Israel in Egypt“ sei, so Thomas Neuhoff, der den Abend moderierte, das einzige Werk Händels, das sich ausschließlich auf Bibeltexte beziehe, nämlich die Erzählung vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten (2. Mose 7 ff.). Gleichzeitig gelte es als das dankbarste Werk Händels für Chöre. „Das Thema Sklaverei, Ausbeutung und Unterdrückung“ sei auch heute noch aktuell, befand Neuhoff angesichts der 3.000 Jahre zurück liegenden Begebenheiten, die der biblische Text schildert und die Händel in seinem Oratorium, das auch schon vor fast 300 Jahren komponiert wurde, verarbeitet. Die musikalische Besonderheit, nämlich der hohe Choranteil, hat zur Zeit seiner Uraufführung beim Publikum wohl eher Unmut erregt , wie Annett Reischert-Bruckmann in ihrem Begleittext vermutet. Um nicht eine einzelne Figur, wie Moses, sondern das ganze Volk Israel in den Mittelpunkt zu stellen, war dies jedoch das glaubwürdigste Vorgehen. Das Werk beginnt mit der Klage Israels über den Tod Josephs und setzt sich in der Handlung 400 Jahre später fort, als die Israeliten in Sklaverei leben. Es folgen die Schilderung der ägyptischen Plagen, der Auszug Israels, der Weg durch das Rote Meer und das Lob Gottes durch Moses und Miriam angesichts ihrer Befreiung.
Musikalische Grundlage des ersten Teils, der Klage Israels, war eigentlich eine Komposition anlässlich der Beerdigung von Königin Caroline 1737. Händel schrieb in „Israel in Egypt“ also nicht nur schamlos bei anderen Komponisten ab, wie Neuhoff betonte, sondern gewissermaßen auch bei sich selbst.
Josephs Klage bleibt aktuell
Der Prolog mit der Klage Israels wird bei heutigen Aufführungen von „Israel in Egypt“ meist nur instrumental aufgeführt. Der Chor des Bach-Vereins beschreitet bei seiner Aufführung einen anderen Weg: Die Stelle des Prologs nimmt die Kantate „Joseph-Lamento“ des deutsch-libanesischen Komponisten Rabih Lahoud ein. Textgrundlage ist ein Gedicht des palästinensischen Nationaldichters Mahmoud Darwish (1941-2008). Er greift den biblischen Stoff von Joseph, der unter seiner Berufung und der Ablehnung durch seine Brüder leidet, auf. Das „Joseph-Lamento“, so Lahoud, der wegen Krankheit nicht teilnehmen konnte, in seinem Begleittext, basiert (…) nur auf wenigen arabischen Worten, die zuerst den Schmerz und dann den Hass verdeutlichen“. Dieser Hass setzte unbändige Energien frei, am Ende soll jedoch „die Hoffnung auf ein Wiedersehen in brüderlicher Liebe und Vergebung“ geweckt werden.
Rechtfertigt Befreiung die Grausamkeit?
Die biblischen Erzählungen von den Plagen, die Gott Ägypten schickt, um das Volk Israel „frei zu pressen“, bis hin zur Tötung der Erstgeborenen lesen sich grausam, besonders das Ende des Textes, als Moses, Miriam und die himmlischen Heerscharen frohlocken wenn die Ägypter mitsamt Pferden und Wagen im Meer versinken. „Dies bezeugt, dass Gott die Freiheit will“ deutete Rainer Stuhlmann, Theologe und Mitsänger im Chor des Bach-Vereins, das biblische Geschehen. Dabei nehme Gott die Perspektive der Unterdrückten ein, die ihren Unterdrückern alle Übel an den Hals wünschen, die sie selber durchmachen müssen.
Musik als Brücke zur Menschlichkeit
Unterdrückung, Gefangenschaft und Folter am eigenen Leib erfahren hat der türkisch-deutsche Schriftsteller Dogan Akhanli, wohl der mit der größten Spannung erwartete Gast des Abends. Hass gegen seinen Folterer, dem er nur mit verbundenen Augen begegnete, habe er jedoch nicht verspürt, betonte er bei der Vorstellung seines neuen Romans „Fasil“. Unterdrückung und Musik verbinden sich darin auf fast schon absurde Weise: Dogan berichtet von seinen eigenen Foltererfahrungen. Der Folterer sang, während er ihn folterte – „aber er wusste nicht, dass er mir damit geholfen hat“ erinnert sich Akhanli. „Er hatte eine unglaubliche Stimme und ein großes Talent“. Er sang Fasil, eine hoch entwickelte, kunstvolle Musikform, bestehend aus einem komplizierten System von Tonleitern und Kompositionsregeln. Vergleichbar ist es am ehesten mit der „Suite“ der europäischen Musik.
Akhanlis neuester Roman „Fasil“ beschreibt den Prozess der Folterung aus der Sicht des Opfers und des Täters. Das Buch lässt sich von zwei Seiten beginnen, eine für die Täter-, eine für die Opferperspektive. Beide „treffen“ sich in der Mitte des Buchblocks. In der Türkei konnte Akhanli, der im vergangenen Jahr durch seine willkürliche Verhaftung in der Türkei Schlagzeilen machte, sein Buch bereits präsentieren, die deutsche Übersetzung ist in Arbeit. In der Trinitatiskirche trug die Rezitatorin Kerstin Baldauf Passagen daraus auf Deutsch vor, übersetzt von Hülya Engin.
Foto(s): von Czarnowski