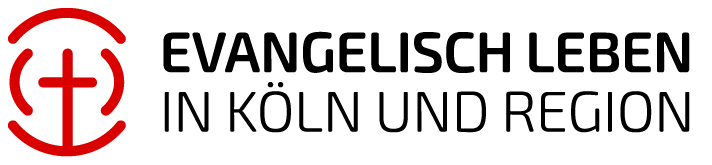Die Evangelische Kirche im Rheinland wird auf landeskirchlicher Ebene in den kommenden sechs Jahren knapp 13,9 Millionen Euro einsparen. Dies beschloss die Landessynode der mit 2,95 Millionen Mitgliedern zweitgrößten Landeskirche in Deutschland am Ende ihrer zweitägigen außerordentlichen Tagung mit großer Mehrheit in Bad Neuenahr. Damit folgten die 236 Synodalen bis auf kleine Veränderungen den Spar- und Strukturvorschlägen, die die Kirchenleitung dem obersten Leitungsgremium vorgelegt hatte.
Ein Drittel weniger Mitglieder bis 2030
Die Beschlüsse seien ein „Anpfiff“, machte die Vorsitzende des Strukturausschusses, Christiane Köckler-Beuser, in ihrer Einbringungsrede am Morgen in der Plenarsitzung deutlich: Der durch zurückgehende Mitgliederzahlen und sinkende Kirchensteuereinnahmen notwendige Veränderungsprozess müsse kontinuierlich weitergehen. Die rheinische Kirche erwartet aufgrund der demografischen Entwicklung bis zum Jahr 2030 einen Rückgang der Mitgliederzahl um rund ein Drittel. Damit ist eine Halbierung der Finanzkraft verbunden.
Der Strukturausschuss hatte im Auftrag der Kirchenleitung rund ein Jahr lang Möglichkeiten des Umstrukturierens und Einsparens mit allen landeskirchlichen Abteilungen, Ämtern und Einrichtungen ausgelotet. Gerade diese intensive Beteiligung aller Betroffenen hat nach Ansicht von Präses Nikolaus Schneider zu breiter Zustimmung zu den Maßnahmen geführt. Gleichwohl bedeuteten die Beschlüsse der Synode „viele schmerzliche Einschnitte, auch für einzelne Menschen“, so Köckler-Beuser.
Das ursprüngliche Sparziel wurde übertroffen
Das für die Jahre 2006 bis 2012 beschlossene Sparpaket entspricht rund 27 Prozent des Kirchensteueranteils (= 51,3 Millionen Euro) am landeskirchlichen Haushalt. In der Evangelischen Kirche im Rheinland liegt die Kirchensteuerhoheit bei den Kirchengemeinden. Das Aufkommen in den 809 Gemeinden, die ihre Spar- und Strukturmaßnahmen vor Ort selbst verantworten, beträgt derzeit rund 500 Millionen Euro. Mit einer gesetzlich festgelegten Umlage von 10,25 Prozent finanzieren die Gemeinden die Arbeit der landeskirchlichen Ebene, die zum Beispiel für die Ausbildung der Theologinnen und Theologen sorgt. Der Haushaltsplan der Landeskirche umfasst im Jahr 2006 insgesamt 86,4 Millionen Euro. „Wir übertreffen unser ursprüngliches Sparziel von 20 Prozent damit deutlich und verschaffen uns ein bisschen mehr Luft für die Zukunft“, kommentierte Vizepräsident Christian Drägert. Der leitende Jurist hat den Strukturreformprozess maßgeblich gesteuert.
Die wichtigsten Punkte im Überblick:
– Trotz des Sparzwangs werden alle zehn Schulen und drei Internate in landeskirchlicher Trägerschaft erhalten bleiben. Um eine Schließung einzelner Schul- bzw. Internatsstandorte vermeiden zu können, werden rund vier Millionen Euro durch die Zentralisierung der Schulverwaltung und durch die Gründung eines Schulwerks eingespart werden. Um aber den Unterhalt und Betrieb der Schulen dauerhaft zu sichern, werden die Eltern künftig um einen freiwilligen Förderbeitrag gebeten.
– Bis zum Jahr 2012 sollen nach dem Beschluss der Synode im Düsseldorfer Landeskirchenamt etwa 39 Vollzeit-Stellen wegfallen. Dies entlastet den Etat um rund 2,3 Millionen Euro. Welche Stellen konkret wegfallen werden, ist unter anderem davon abhängig, welche Aufgaben die Landeskirche für die derzeit 809 Gemeinden und 44 Kirchenkreise in Zukunft noch wahrnehmen soll. Diese Diskussion wird u.a. die reguläre Landessynode im Januar 2007 beschäftigen.
– Knapp eine Million Euro wird die bereits beschlossene Fusion der Kirchlichen Hochschulen Wuppertal und Bethel zum 1. Januar kommenden Jahres an Einsparung erbringen.
– Der Betrag, den die Landeskirche jährlich in den seit rund 30 Jahren bestehenden Arbeitslosenfonds einzahlt, wird um 20 Prozent gekürzt; das entspricht mehr als 610.000 Euro. Bei allen früheren Sparbeschlüssen war der Fonds stets unangetastet geblieben. In Zukunft fließen jährlich noch immer 2,45 Millionen Euro in diese Arbeit.
– Zu rund einer halben Million Euro Minderausgaben sollen Veränderungen im Bereich der Studierendengemeinden (ESG) führen. Da eine flächendeckende landeskirchliche Präsenz nicht mehr möglich ist, sollen sich die Studierendengemeinden künftig auf eine exemplarische Arbeit an den Hochschulen konzentrieren.
– Veränderungen gibt es auch beim Amt für Sozialethik. Dessen Arbeitsgebiet bleibt im Landeskirchenamt. Gleichzeitig aber soll die Verzahnung mit der Arbeit der Evangelischen Akademie im Rheinland mit Sitz in Bonn verbessert werden. Zudem wird ein sozialethischer Lehrauftrag an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal angestrebt. Diese Neustrukturierung schlägt mit knapp 330.000 Euro Einsparungen zu Buche.
Außerdem: Sonderdienst beendet und den Probedienst verkürzt
Das Sonderdienstmodell der rheinischen Kirche gehört bald der Vergangenheit an. Das beschloss die Synode in Bad Neuenahr. Es werden keine neuen Sonderdienststellen mehr errichtet. Bereits vorhandene Stellen werden beim Ausscheiden von Stelleninhaberinnen und -inhabern aufgehoben. Um Theologinnen und Theologen mit abgeschlossenem Probedienst (früher „Hilfsprediger-Dienst“) die Möglichkeit einer befristeten Beschäftigung zu geben, hatte die Evangelische Kirche im Rheinland 1985 den so genannten Sonderdienst eingerichtet. Die Zahl der ausgebildeten Theologinnen und Theologen lag höher als die Zahl der frei werdenden Pfarrstellen – von „Pfarrerschwemme“ war die Rede. Der Sonderdienst wurde zum Erfolgsmodell. Im Gegensatz zu anderen Landeskirchen, in denen Vikarinnen und Vikare ohne Pfarrstellen blieben und sich anderweitige Jobs suchen mussten, wurden in der rheinischen Kirche neue Arbeitsfelder mit „Sonderdienstlern“ im Dienstverhältnis besetzt. Ob in der Ausländer- und Aussiedlerarbeit, in der Notfallseelsorge, der Schulseelsorge und in der Öffentlichkeitsarbeit, um nur einige Beispiele zu nennen – überall konnten Aufgaben übernommen werden, die außerhalb des gewohnten pastoralen Dienstes lagen.
Das einstige Erfolgmodell ist zur Sackgasse geworden
Der Sonderdienst, finanziert aus einem landeskirchlichen Fonds, dauerte fünf Jahre und konnte um weitere fünf Jahre verlängert werden. Für viele Stelleninhaberinnen und -inhaber war er ein Sprungbrett in den Pfarrdienst: Fast zwanzig Jahre lang wurden ca. 75 Prozent eines jeden Jahrgangs aus dem Sonderdienst in Pfarrstellen gewählt. Von 1985 bis heute waren bzw. sind 796 Menschen im Sonderdienst beschäftigt. Davon wechselten 491 in Pfarrstellen, 191 schieden aus, 164 sind noch heute im Sonderdienst. Seit 2004 hat sich das Zahlenverhältnis von gewählten und entlassenen Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst jedoch aufgrund der problematischen Stellensituation (im Jahr 2004: 55 Ausschreibungen, im Jahr 2005: 43 Ausschreibungen) umgekehrt. Von denjenigen, die ab Oktober 2005 bis 2010 ihren fünfjährigen Sonderdienst beenden, werden voraussichtlich nur 25 Prozent in den Pfarrdienst übernommen werden können. Das einstige Erfolgsmodell ist „zu einer Sackgasse geworden“, heißt es dazu kurz und bündig in der Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode. Das Sonderdienst müsse beendet werden, um den Betroffenen eine rasche berufliche Neuorientierung zu ermöglichen.
Perspektivberatung soll sechs Monate dauern
Doch nicht nur das: Aus dem Sonderdienst ausscheidenden Personen wird eine „Perspektivberatung“ angeboten, die sechs Monate umfasst. Hauptaufgabe soll es sein, je nach den individuellen Kompetenzen geeignete berufliche Einsatzfelder zu finden. Ein entsprechendes Pilotprojekt der Beratungs- und Qualifizierungsmaß-nahmen ist bereits angelaufen. Daran nehmen fünf Personen aus dem Sonderdienst und fünf Personen aus dem Probedienst teil, der verkürzt werden soll. Der Probedienst schließt sich an die Ausbildung von Theologinnen und Theologen nach Vikariat und Zweitem Examen an. Der dreijährige Probedienst sei zu lang, hätten die Erfahrungen gezeigt, so die Begründung in der Vorlage. Gleichzeitig sei er für Aufgaben mit dauerhaften Wirkungen zu kurz. Deshalb sollen ab Oktober 2006 Pfarrerinnen und Pfarrer zur Anstellung nur zwei Jahre ihren Dienst tun.
Foto(s): EKV