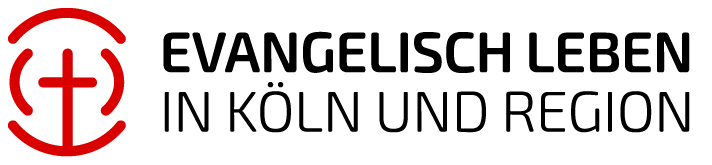Jetzt steht fest: Der freie Platz zwischen Schildergasse, Antoniterstraße 14 und dem AntoniterCity-Pavillon an der Antoniterkirche wird Ina-Gschlössl-Platz heißen. Damit folgte die Bezirksvertretung Köln-Innenstadt einem Antrag der Evangelischen Gemeinde Köln – fast einstimmig, dagegen votierte nur „Pro Köln“. Wer war diese Frau?
Eine Frau, die „alles riskierte“
Die Evangelische Gemeinde Köln hatte diesen Vorschlag gemacht, um eine evangelische Theologin zu ehren, die nicht nur viel für die Gleichberechtigung der Frauen in der Evangelischen Kirche getan, sondern auch den Nationalsozialisten auf ihre Weise getrotzt hat. Eine Frau, „die alles riskierte. Eine gute Theologin“, würdigte sie Pfarrer Hans Mörtter in dem Antrag an die Stadt Köln, wie auf der Internetseite der EKiR hier nachzulesen.
Zur Lehrerin „abkommendiert“
Ina Gschlössl, wie sie von allen genannt wurde, wurde 1898 als Nikolaine Maria Elisabeth Gschlössl in Köln-Nippes geboren. In Köln ging sie zur Schule, ab 1920 studierte sie, zunächst Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, dann Philologie und Theologie, zuerst in Bonn. 1926 legte sie ihr erstes theologisches Examen in Marburg ab, machte ein Vikariat bei dem evangelischen Pfarrer Georg Fritze in der Kölner Südstadt. Ab 1927 arbeitete sie hauptamtlich als theologische Berufsschullehrerin in Köln. Für Gschlössl keineswegs das Ziel ihrer Wünsche: „Abkommandiert“ worden sei sie dorthin, schreibt sie später. Ihr Ziel war die gleichbereichtigte Arbeit in der Kirche, also die Möglichkeit, das zweite theologische Examen abzulegen und ein „volles Pfarramt“ zu erlangen. Doch das erlaubte die damalige Gesetzeslage Frauen nicht.
Gleiche Rechte für Männer und Frauen
Frauen konnten zwar Vikarinnen werden, aber: „Ausdrücklich ausgeschlossen blieben sie von den Funktionen des männlichen Pfarramts, wie dem Gemeindegottesdienst, der Sakramentverwaltung und anderen vom Pfarrer zu vollziehenden Amtshandlungen“, resümierte Gschlössl schon früh. Dies war das eine Ziel ihres erstaunlichen Werdegangs: Für Theologinnen die gleichen Rechte zu erstreiten, wie die männlichen Kollegen sie selbstverständlich hatten. Aus „tiefstem Interesse und dem Anspruch, der Kirche zu dienen“, gründete sie darum schon 1925 in Marburg gemeinsam mit drei anderen Theologinnen den „Verband Evangelischer Theologinnen“, den es ab 1930 auch in Köln gab. Der Kampf war hart, denn Theologinnen sollten nach dem Willen der „Kirchenoberen“ ausschließlich in Gefängnissen, Krankenhäusern und Mädchenheimen, als Jugendpfarrerin, Studentenseelsorgerin oder Religionslehrerin arbeiten – unter keinen Umständen aber als Gemeindepfarrerin mit allen dazu notwendigen Rechten. Dieser Kampf dauerte übrigens noch sehr lange: Erst seit 1975 sind deutsche Theologinnen den Männern wirklich mit allen Rechten gleichgestellt.
„Ungeziemende Bemerkungen“
Der andere Kampf, den Ina Gschlössl führte, war aber vielleicht noch härter: Wie Pfarrer Georg Fritze lehnte sie den NS-Staat entschieden ab. Sie engagierte sich in der SPD, veröffentlichte mit den „Aufsätzen zur Kirchenfrage – Gegenwartsnöte der evangelischen
Kirche“ Kritisches über das Verhältnis von Kirche und Nationalsozialismus. 1933 entließ die Stadt Köln sie als Theologin aus dem Berufsschuldienst, weil sie „ungeziemende Bemerkungen über den Herrn Reichskanzler und andere Staatsmänner gemacht und sich über die Judenfrage in einer Art und Weise ausgelassen hat, die jedes Verständnis für den nationalen Standpunkt vermissen lassen.“ Gschlössl setzte sich die ganze Zeit des Zweiten Weltkriegs über für Gefangene und „halb- und nichtarische“ evangelische Christinnen und Christen ein, und sie kümmerte sich um eine jüdische Familie – mitten im nationalsozialistischen Köln.
Wiederaufbau
Ihre klare Kampfansage an den Nationalsozialismus half ihr nach Kriegsende: „Fräulein Gschlössl hatte wesentlichen Anteil an dem Wiederaufbau unserer Arbeit, wobei ihr die klare kirchliche und politische Stellung, die sie in den früheren Jahren angenommen hatte, sehr zu Hilfe kam. So verdanken wir ihr viel für den Neubeginn und Wiederanknüpfung der zerstörten Fäden“, schrieb ihr Superintendent Hans Encke 1946 ins Zeugnis. Da arbeitete Gschlössl weiterhin als Lehrerin – was in den Nachkriegsjahren eine große Herausforderung bedeutete: Im zerbombten Köln von 1946 fehlte es an allem: Es gab keine Klassenräume, kaum ausreichend ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, keine Konzepte oder Lehrpläne, kein Arbeitsmaterial. Ina Gschlössl organisierte all dies und noch weit mehr – ihre Arbeitsräume hatte sie übrigens lange Zeit im heutigen Haus der Evangelischen Kirche in der Kartäusergasse. 1966 ging sie in Rente, 1989 starb Ina Gschlössl mit 91 Jahren in Neusäß bei Augsburg.
Foto(s): Archiv